|
Der Mensch
verfügt über ein Atemsystem mit einem effektiven
Selbstreinigungsmechanismus
gegenüber verunreinigter Luft. Mit "normalem" Schmutz wird dieses Filtersystem
mühelos fertig und schützt uns ziemlich perfekt. Aber auf eine übermäßige
Belastung, wie vor allem durch aggressive Stoffe wie Schwefeldioxid, Stickoxide
oder Ozon, durch lungengängige Stäube mit angelagerten toxischen Substanzen
wie adsorbierte Säuren, Schwermetalle,
Zigarettenrauch und
Autoabgase oder durch das geruchlose
Atemgift Kohlenmonoxid ist unser Filtersystem nicht eingerichtet.
Die feuchten Oberflächen des Atemtraktes und die Schleimhäute der Augen
stehen in direktem Kontakt mit Luftschadstoffen und bilden daher die
primären Einwirkungsflächen. Reizstoffe wirken meist unmittelbar auf ihre
oberflächlichen Strukturen.
|
Eine
langandauernde Exposition kann zur Zerstörung der Schleimhaut mit
irreversiblem Verlust von Flimmerhärchen und der schleimproduzierenden
Becherzellen führen. Der Abtransport von Schleim mit darin
enthaltenen Partikeln bzw. gelösten Schadstoffen wird beeinträchtigt.
In Abhängigkeit von Angriffsort, Wasserlöslichkeit und Dosis können
Reizstoffe unterschiedlich tief in den Atmungstrakt eindringen und
sehr verschiedene Beeinträchtigungen hervorrufen wie Reizungen oder
Entzündungen der oberen Atemwege, Schleimabsonderungen und Hustenreiz,
ebenso Bronchitis und Entzündungen der Bronchien und des Lungengewebes.
|
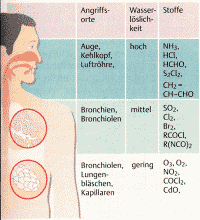
|
| Quelle:
Taschenatlas der Umweltchemie, Thieme-Verlag 1996, G. Schwedt, J.
Schreiber (Farbtafeln) |
Partikelförmige
Schadstoffe im Atemtrakt gelangen bis tief in die Lungenperipherie zu den
Lungenbläschen, wenn ihr Durchmesser kleiner als 2µm ist. In den feinsten
Verästelungen der Lunge schleicht sich der Feinstaub heimlich ins Blut und
in die Lympfbahnen. Größere Partikel werden in den oberen Atemwegen festgehalten
und in der Regel durch Flimmerhärchen in einem
Selbstreinigungsmechanismus
nach außen befördert. Deponierte Teilchen, die mit Hilfe der Flimmerhärchen
des Atemtraktes in den Verdauungstrakt übertreten, können dort resorbiert
und biologisch wirksam werden.
|
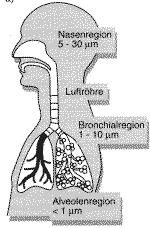
|
In Ballungszentren
inhaliert der Mensch mit jedem Atemzug Millionen von Feinpartikeln,
die kleiner als 10µm sind. Sie bieten aufgrund ihrer zerklüfteten
Struktur eine ideale Oberfläche für die Anlagerung von weiteren
toxischen Substanzen. In Abhängigkeit von den physikalischen und
chemischen Eigenschaften sowie der Einwirkzeit können sie zu Schädigungen
führen wie Husten, vermehrte Infektion der oberen und unteren Atemwege,
Bronchitis, Asthmaanfällen, Schnupfen sowie Erkrankungen des Herz-
Kreislaufsystems und Lungenkrebs. Die Lungenfunktion wird negativ
beeinflusst und die Immunabwehr von Risikogruppen abgeschwächt.
Staub aus besonderen Quellen kann auch mutagene oder kanzerogene
Wirkung haben. |
| Quelle: Toxikologisches
Lexikon zum Umweltchemikalienrecht, Vogel Buchverlag 1996, G. Schwedt |
Trotz besserer Luft
durch Verminderung des Ausstoßes der bisher überwachten klassischen Luftschadstoffe
steigt die Anzahl der Lungenerkrankungen und die der allergischen Reaktionen
weiterhin allgemein an. Die
Fremdstoffe, die gegenwärtig in der offenen Atmosphäre eine Rolle spielen,
sind Stickoxide, Ozon und Feinstaub mit einer Teilchengröße, die kleiner
als 2 µm sind. Im Visier geraten sind zunehmend die allerkleinsten Teilchen,
die kleiner als 0,1µm sind.
| Größenvergleich:
0,05µm, 0,5µm und 5µm große Partikel in Relation zu einem
Makrophagen. Je kleiner
der Durchmesser von Fremdstoffteilchen ist, desto schlechter können
Makrohpagen in der Lunge diese "Eindringlinge" erkennen - so eine
Hypothese über die biologische Wirksamkeit feiner Partikel. |

|
|
Qeulle: "mensch+umwelt,
spezial", 12/1998, GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit,
J. Heyder
|
Die Partikel werden dann nicht
von den Abwehrzellen aufgenommen, sondern können in das Lungengewebe eindringen
und dort entzündliche Reaktionen auslösen. Da angenommen wird, dass die
ultrafeinen Teilchen ursächlich an der Zunahme der Lungenkrankheiten beteiligt
sind, ist höchste Aufmerksamkeit geboten. Denn die ohnehin sehr große Anzahl
dieser kleinen Teilchen in der Atemluft nimmt weiter mit steigendem motorisierten
Verkehrsaufkommen zu.
|

